Psychologische Intervention
Programmtheorie - 2. Bereichsspezifische Risiko- und Schutzfaktoren (Entwicklungspsychopathologie)
Bereichsspezifische Risiko- und Schutzfaktoren
Problem:
==> Zusammenfassung zu Gesamtmodellen der Entwicklung lohnend
Struktur/ Methode analytischer Epidemiologie [2]
Interventionsebenen (5)
Interventionsebenen
Systematische Evaluation - Metaanalytische Ergebnisse zu Präventionsmaßnahmen bei Kindern und Jugendlichen (Beelmann, 2006, 2016)
Rangreihe Effektstärken:
==> Insg. große Variabilität
Weitere aktualgenetisch bedeutsame Aspekte - Barrieren der Veränderung [6]
Barrieren der Veränderung
Bronfenbrenners Ökologische Systemtheorie - Implikationen für Psychologische Intervention
Implikationen für Psychologische Intervention
Kennwerte zur Beschreibung kategorialer Vergleiche epidemiologischer Daten - Odds Ratio
Odds Ratio
(krank & Risiko : Nicht-krank & Risiko) : (krank & kein Risiko : nicht-krank & kein Risiko)
Aktualgenese - Prinzipien menschlicher Informationsverarbeitung (Neisser, 1969) [2]
Prinzipien menschlicher Informationsverarbeitung
Weitere Menschliche Veränderungsprinzipien - Individualität des Entwicklungsgeschehens
Interventionstheorie - Breitbandmethoden Psychologischer Intervention (einf gängige Methoden wie PT)
Breitbandmethoden Psychologischer Intervention
Programmtheorie - Bisherige Interventionen und Interventionsforschung
Aus welchen Fragen zu bisherigen Interventionen kann man die Inhalte für die Interventionsforschung ableiten?
Aus welchen Fragen zu bisherigen Interventionen kann man die Inhalte für die Interventionsforschung ableiten?
==> Ableitung von Inhalten i.d.R. unmittelbar möglich
Problem:
Zielgruppen und Eingriffsintensität versch. Interventionen [Pyramide]
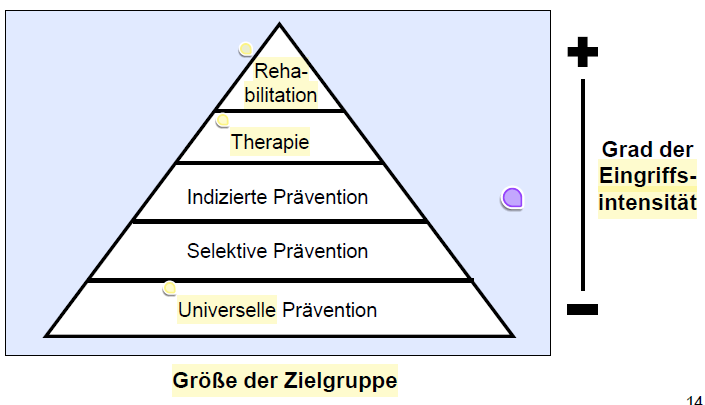
Epidemiologie
Epidemiologie - Arten
Veränderungsphasen in der Entwicklung (Ontogenese)
Welche Veränderungsphasen in der Entwicklung gibt es?
Empirische und normative Begründung von Zielen und Mitteln
Empirische Begründung von Zielen
Normative Begründung von Zielen und Mitteln
Interventionstheorie - 1. Grundeinheiten - Methodik
Methoden (Art der interventiven Arbeit)
Programmtheorie - 1. Rahmenmodelle
Zentrale Aspekte zur Unterscheidung der Theorien
Unterscheidung anhand:
Problem; Konzepte sehr allgemein im Hinblick auf konkrete Ableitungen für Interventionsinhalte
Aktualgenese - Vygotskys Zonen der nächsten Entwicklung
Vygotskys Zonen der nächsten Entwicklung
Grundannahme
Implikationen
Programmtheorie - Entwicklungspfade/ Problemtypen
Entwicklungspfade/ Problemtypen
==> Identifikation einzelner Entwicklungspfade z.B. innerhalb des Bio-psycho-sozialen Entwicklungsmodells einer best. Erkrankung
(Interindividuelle Unterschiede: Weg zu persistent delinquentem Verhalten über schwieriges Temperament --> Ablehnung durch Peers vs. Genetische Faktoren --> verzerrte Infoverarbeitung)
Problem:
Epidemiologische Grundbegriffe [3]
(Inzi, Präva, Risiko)
Epidemiologische Grundbegriffe
==> hfg. herangezogen zur Legitimation von Interventionen
Argumente für Psychologische Gesundheitsförderung und Prävention [5]
Argumente für Psychologische Gesundheitsförderung und Prävention
Programmtheorie - Modell der Developmental Assets (Beispiel für Ansätze positiver EW)
Developmental Assets
Internal Assets
==> Internal Assets meist Ansatzpunkt von Interventionen
External Assets:
Kennwerte zur Beschreibung kategorialer Vergleiche epidemiologischer Daten - Spezifität
Spezifität
Analyse von Interventionszielen
Dimensionen von Interventionszielen
Globalziele psychologischer Interventionen [3]
Globalziele psychologischer Interventionen
Systemische Modelle
Systemische Modelle
Annahme
Merkmale
Gesundheitsförderung und Prävention - Kontinuität Health ease–Healthdisease (HE-DE-Konzept)
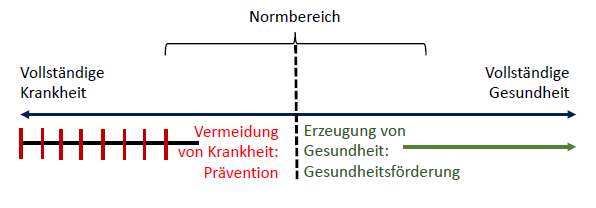
Interventionstheorie - 1. Grundeinheiten - Intensität
Intensität
Bereitstellungs- und Intensitätsmodelle:
Anwendung von Gesundheitsförderung und Prävention - Anwendungsgebiete
Anwendung von Gesundheitsförderung und Prävention - Anwendungsgebiete
Welche 3 Arten von Interventionen werden unterschieden?
Welche Zielgruppen sollen diese adressieren?
Transaktionale Entwicklungsmodelle - Implikationen für Psychologische Intervention [3]
Implikationen für Psychologische Intervention
Empirische und praktische Bewährung - Levels of Evidence [5]
Levels of Evidence
Level I - Meta-Analysis or systematic review of level II studies incl. quantitative analysis
Level II - study of test accuracy (double blinded, independent, valid reference standard)
Level III-1 - pseudorandomized controlled trial
Level III-2 - comparative study with concurrent controls
Level IV - Case series with either post test or pretest/ posttest outcomes
theoretischer Zusammenhang zw. guter/ schlechter Programmtheorie & Interventionstheorie mit Erfolgswahrscheinlichkeit (Schaubild)
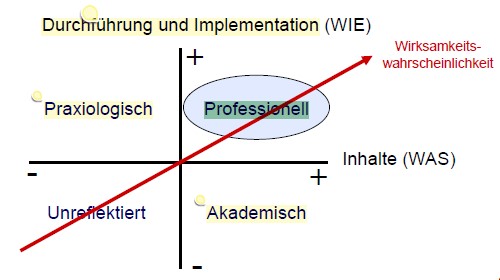
Modell zur wissenschaftlichen Fundierung von Präventions- und Interventionsmaßnahmen (Beelmann, 2012)
1. Legitimation der Maßnahmen
1.1 Problemdefinition
1.2 Entwicklungsprognosen
1.2 Entwicklungsprognosen
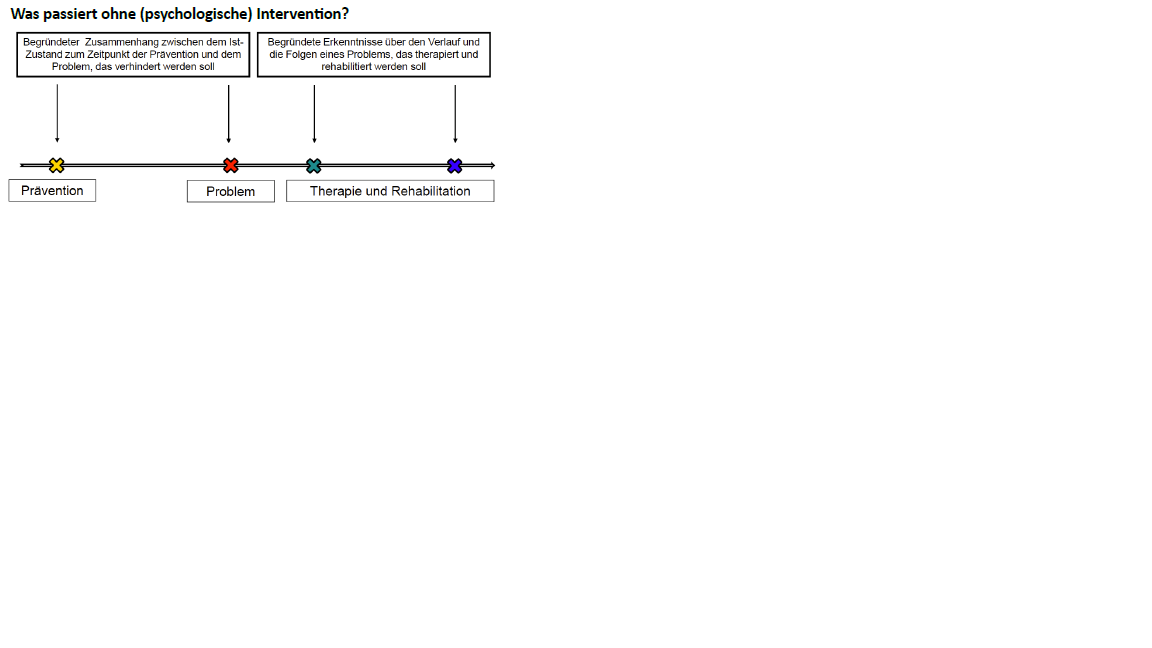
Rehabilitation - Bereiche und Aufgabenfelder
Vier Kernanwendungsbereiche der Rehabilitation
2 Arten von Veränderungstheoretischen Konzepten
Ontogenetische Konzepte (langfristige Veränderung im entwicklungs-/ Lebensverlauf)
Aktualgenetische Konzepte (kurzzeitige, situative Veränderung)
Interventionstheorie - Klassifikation psychologischer Methoden [2.3]
Klassifikation psychologischer Methoden
Gesundheitsförderung und Prävention - Salutogenesekonzept (Antonovsky)
Salutogenesekonzept (Antonovsky)
Zentrale Frage
Grundannahmen
Risikoschutzfaktorenmodell
= Kompensationsmodell
==> Kompetenzen stärken und Risiken reduzieren!
Kritische Lebensereignisse - Sexueller Missbrauch
Sexueller Missbrauch - Programmansätze
Typische Programminhalte (kinderorientierte Ansätze)
Prinzipien der Entstehung von Entwicklungsproblemen - Entwicklungspsychopathologie
Welche 2 Faktoren liegen laut der Entwicklungspsychopathologie der Ursache von Problemen zugrunde ?
Fehlentwicklungen --> Resultat eines ungünstigen Verhältnisses zw. Risikofaktoren (Vulnerabilität & Belastung) und Schutzfaktoren (Resilienz & Ressourcen)
Verhaltensprobleme --> Resultat komplex zusammenwirkender Faktoren (Anzahl & Stärke des Zusammenhangs) im Entwicklungsverlauf
Aktualgenetische Veränderungsmodelle - Transtheoretisches Modell (TTM) der Verhaltensänderung (Prochaska & DiClemente, 1982ff.)
Transtheoretisches Modell (TTM) der Verhaltensänderung
Unterscheidung zwischen Gesundheitsförderung und Prävention
Unterscheidung zwischen Gesundheitsförderung und Prävention
Was spricht für eine psychologische Intervention? (Voraussetzungen/ Legitimierung psycholog. Interventionen)
Was spricht für eine psychologische Intervention?
Kritische Lebensereignisse - Sexueller Missbrauch
Sexueller Missbrauch
Auswirkungen:
Kennwerte zur Beschreibung kategorialer Vergleiche epidemiologischer Daten - Sensitivität
Sensitivität
Interventionstheorie - Soziale Interaktion
Elaboration-Likelihood-Modell
Zwei Wege:
Systematische Evaluation - Ergebnisse meta-analytischer Studien
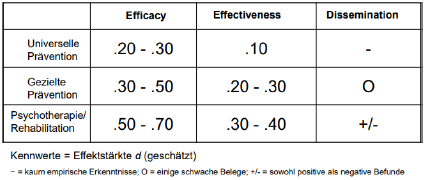
Ontogenese - Transaktionale Entwicklungsmodelle (Weiterentw. von Beelmann)
Biologische Regulationssysteme
Soziale Regulationssysteme
Selbstregulationssysteme
Kritik:
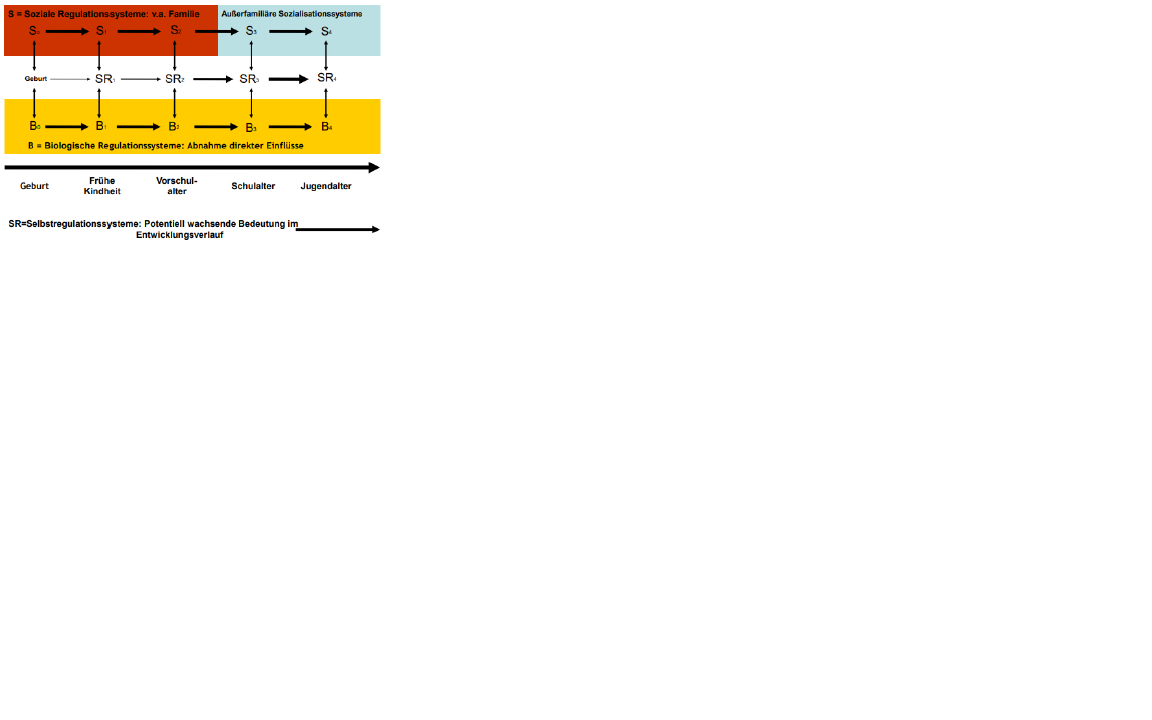
Theorie zur Entstehung von Entwicklungsproblemen - Problem Behavior Theory (Jessor, 2016)
Risikoverhalten und problematischer Lebensstil
Drogenprävention - "Life-Skill-Ansatz" von Botvin (Lebenskompetenzen)
"Life-Skill-Ansatz" von Botvin
Formulierung einer Programmtheorie - Informationsquellen für Inhalte der Intervention [6]
Informationsquellen für Inhalte der Intervention (=Programmtheorie)
Modell zur wissenschaftlichen Fundierung von Präventions- und Interventionsmaßnahmen (Beelmann, 2012)
1. Legitimation der Maßnahmen
1.1 Problemdefinition
3 Begründungsansätze
Interventionsanlässe/ Allgemeine Indikation vorhanden?
3 Begründungsansätze:
Systematische Evaluation - Methodische Grundfragen der Evaluation [6]
Methodische Grundfragen der Evaluation
==> Erfolgsbilanz stark abh. von zugrundeliegenden Kriterien
Interventionstheorie - Methoden und Strategien der Intervention
Methoden und Strategien der Intervention – Einfluss auf individuelles Verhalten und Grad der Zielerreichung
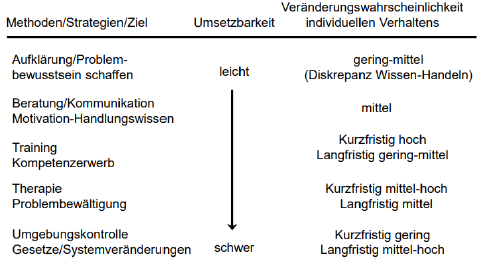
Gesundheitsförderung und Prävention - Klassifikation Psychologischer Prävention
Epidemiologie - Definition
Definition:
"Wissenschaft der Verteilung und der Ursachen von Krankheitshäufigkeiten [und Gesundheitsparametern] in menschlichen Populationen."
Gesundheitsförderung und Prävention - Klassifikation Psychologischer Prävention
Aktualgenese - Basale Lernprinzipien (v.a. Bandura, 1977)
Basale Lernprinzipien
Menschliches Lernen anhand versch. Lernarten (Lernprozessen) zu konzeptualisieren:
==> Interventionen müssen lerntheoretisch fundiert sein für max. Erfolgsaussichten
==> Zudem Beachtung untersch. Lernstile (visuell, handlungsorientiert)
Kennwerte zur Beschreibung kategorialer Vergleiche epidemiologischer Daten - Relatives Risiko
Relatives Risiko
Psychologische Methoden und Mittel
Professionelle Interaktion und Kommunikation
Kennwerte zur Beschreibung kategorialer Vergleiche epidemiologischer Daten - Basisrate
Basisrate
= Prävalenzrate
Aktualgenetisch bedeutsame Aspekte - Implikation für die Interventionsentwicklung [5]
(Aktualgenetische Theorien, Widerstände, Zieldifferenzen, Hohes Anspruchsniveau, Identitätsangreifend, Wertdifferenzen, neg. Stereotype)
Implikation für die Interventionsentwicklung
Menschliche Veränderungsprinzipien - Multikausalität: Bio-psycho-soziale Regulation
==> nicht leicht veränderbar
==> Ursachenkombination!
Vor- und Nachteile verschiedener Präventionsmaßnahmen [PRÜFUNGSFRAGE]
Vor- und Nachteile verschiedener Präventionsmaßnahmen
| Interventionstyp | Vorteile | Nachteile |
|
Universelle Prävention |
|
|
| Gezielte Prävention |
|
|
Aktualgenetische Veränderungsmodelle - Health-Belief-Modell (HBM) (Becker et al., 1974)
Health-Belief-Modell
Interventionstheorie - Soziale Interaktion
Personenwahrnehmung und Einschätzungsverzerrungen
Kritik von Interventionszielen
Kritik von Interventionszielen
Worauf bezieht sich die Programmtheorie/ Interventionstheorie allgemein? - Stichwort
Programmtheorie = Inhalte der Intervention (WAS)
Interventionstheorie = Durchführung und Implementation (WIE)
Vor- und Nachteile verschiedener Interventionsstrategien - Gezielte Prävention
Gezielte Prävention
Vorteile
Nachteile
Menschliche Veränderungsprinzipien (EWPSY) [11]
Menschliche Veränderungsprinzipien
Meta-Analyse deutschsprachiger Präventionsstudien - Erfolgskriterien
Meta-Analyse deutschsprachiger Präventionsstudien - Erfolgskriterien
Zusammengefasst:
mittlere bis kleine Effekte auf:
kleine Effekte auf:
keine/ zu vernachlässigende Effekte:
Gesundheitsförderung und Prävention - Generalisierte Widerstandsressourcen (Antonovsky)
Generalisierte Widerstandsressourcen (heute: Schutzfaktoren)
Essenzielle Bestandteile gelungener Implementation
Essenzielle Bestandteile gelungener Implementation
Modell zur wissenschaftlichen Fundierung von Präventions- und Interventionsmaßnahmen (Beelmann, 2012)
1. Legitimation
Gesundheitsförderung - Kohärenzgefühl (Antonovsky)
= sense of coherence/ SOC (Antonovsky)
Definition
Drei Teilkomponenten (entscheidend für Stärke des SOC)
Fünf Zentrale Bedingungen der wissenschaftlichen Fundierung psychologischer Interventionen [5]
Fünf Zentrale Bedingungen der wissenschaftlichen Fundierung psychologischer Interventionen
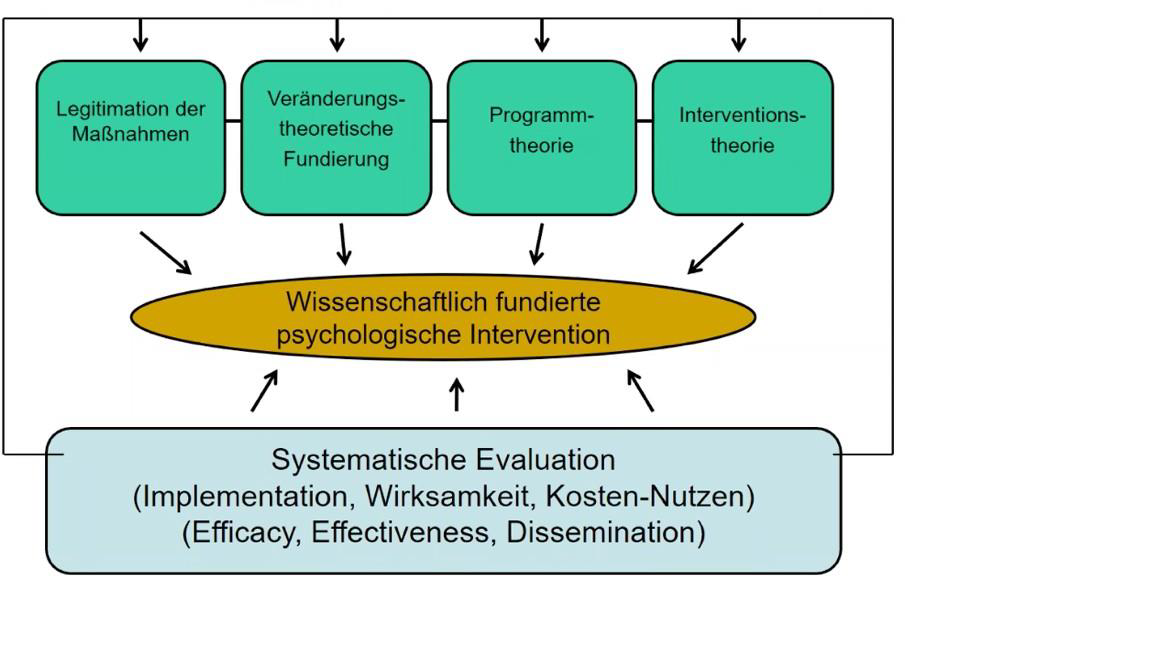
Sexueller Missbrauch - Programmansätze
Programmansätze - Evaluation
Interventionstheorie - Didaktik
Aspekte:
Arten und Zielgruppen der Prävention [3, 1 Überkategorie]
2. & 3. ==> Gezielte Prävention (targeted prevention)
Aktualgenese - Lösungsversuche (Watzlawik, 1974)
Lösungsversuche als Ursache/ Aufrechterhaltung von Problemen:
3. Utopie-Syndrom
4. Paradoxien
Interventionstheorie - Menschliche Kommunikation und Interaktion
Pragmatische Axiome menschlicher Kommunikation (Watzlawik) [6]
Pragmatische Axiome menschlicher Kommunikation (Watzlawik)
Empirische und praktische Bewährung - Evidenzbasierte Verzeichnisse
Kriterien angeben für:
(task force der APA)
Probably Efficacious Treatments
oder
oder
oder
Merkmale wirksamer Programme - Durchführungskonzept [6]
Merkmale wirksamer Programme - Durchführungskonzept
Interventionsplanung in der Praxis
Interventionsplanung in der Praxis
Systematische Evaluation - Übersicht zu Ergebnissen psychologischer Intervention
Allgemeine Ergebnisse (Lipsey & Wilson, 1993)
Übersicht zu Ergebnissen psychologischer Intervention
Allgemeine Ergebnisse (Lipsey & Wilson, 1993)
Weitere Menschliche Veränderungsprinzipien - Heterotypische Kontinuität
Heterotypische Kontinuität
Aktualgenese - Implikationen für Psychologische Interventionen (durch Prinzipien des Lernens, Informationsverarbeitung, Handlungsregulation) [3]
IMPLIKATIONEN FÜR DIE PSYCHOLOGISCHEN INTERVENTION
Sensible Phasen - Implikationen für die psychologische Intervention
Welche Implikationen kann man aus sensiblen Entwicklungsphasen für die Interventionen ableiten? [9]
Entwicklungskontexte nach Bronfenbrenner
Entwicklungskontexte nach Bronfenbrenner
Systemebenen
Zentrale Aussagen
Zentrale Annahmen sozialwissenschaftlicher Modelle [4]
Zentrale Annahmen sozialwissenschaftlicher Modelle
Legitimation - a priori Entscheidungskriterien bei Indikationsfragen für psych. Interventionen [6]
Weitere Menschliche Veränderungsprinzipien - Vorübergehende Natur von Entwicklungsproblemen
Programmtheorie - Ätiologische Theorien kurzer bis mittlerer Reichweite
Ätiologische Theorien kurzer bis mittlerer Reichweite
Probleme:
Weitere Menschliche Veränderungsprinzipien - Sensible Phasen/ Entwicklungsaufgaben
Sensible Phasen
Rehabilitation - Bereiche und Aufgabenfelder
Rehabilitation =
Zielgruppen
Entwicklung der Präventionsgesetzgebung
Entwicklung der Präventionsgesetzgebung
Inhalte:
Ziele psychologischer Interventionen (Allgemein)
Ziele psychologischer Interventionen
Aktualgenetische Veränderungsmodelle - Nur nennen [4]
Programmtheorie - 2. Bereichsspezifische Risiko- und Schutzfaktoren (Entwicklungspsychopathologie)
Bereichsspezifische Risiko- und Schutzfaktoren
Biologisch
Psychologisch
Sozial
Probleme:
Aktualgenetische Veränderungsmodelle - HAPA-Modell (Health Action Process Approach)
Health Action Process Approach (HAPA)
Kritik von Beelmann:
Gesundheitsförderung und Prävention - Definition Gesundheit (Franke)
Definition Gesundheit (n. Franke; 2006)
Bio-psycho-soziale Modelle
Bio-psycho-soziale Modelle
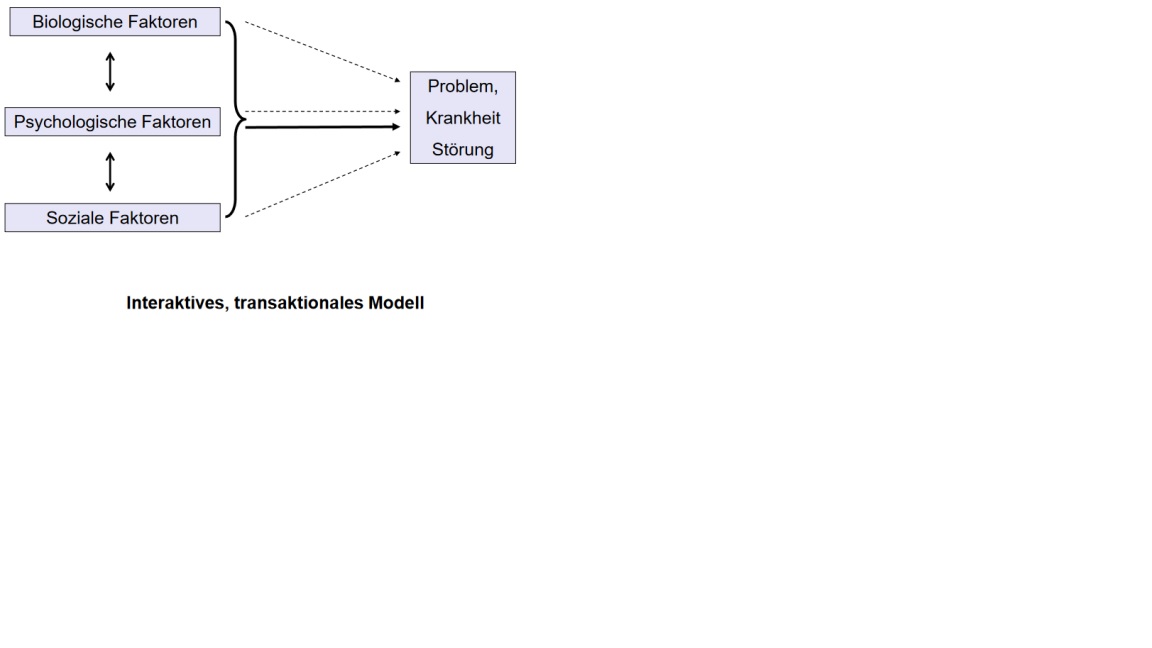
Interventionstheorie - 1. Grundeinheiten - Timing
1. Timing (altersbezogener Beginn, sit. Gelegenheiten)
Grundlagen der Interventionsplanung - Konkrete Anwendung psych. Interventionen im Einzelfall [5]
(Anpassung von Beelmann's Modell auf den Einzelfall)
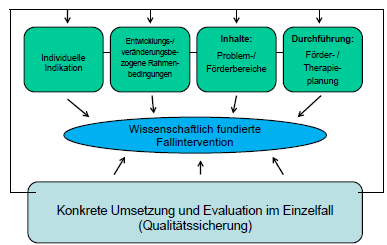
Soziale Trainingsprogramme / Sozial-kognitive Therapien
Soziale Trainingsprogramme / Sozial-kognitive Therapien
Interventionstheorie - Soziale Interaktion
Persuasive Kommunikation
= Kommunikation, die auf Einstellungsänderung ausgerichtet ist
Menschliche Veränderungsprinzipien - Verhältnis von Risiko zu Protektion
Schutz-/ Kompensationsmodell
Verhältnis von Risiko zu Protektion
==> Konsequenz für Intervention: Risikofaktoren abmildern/ abbauen oder Schutzfaktoren aufbauen

Interventionstheorie - Grundvoraussetzungen beim Interventions-Administrator
Grundvoraussetzungen beim Interventions-Administrator
Programmtheorie - Bedingungen positiver Entwicklung
Ziel:
Problem:
Aktualgenetische Veränderungsmodelle - Theorie des geplanten Verhaltens (Ajzen,1985)
Theorie des geplanten Verhaltens
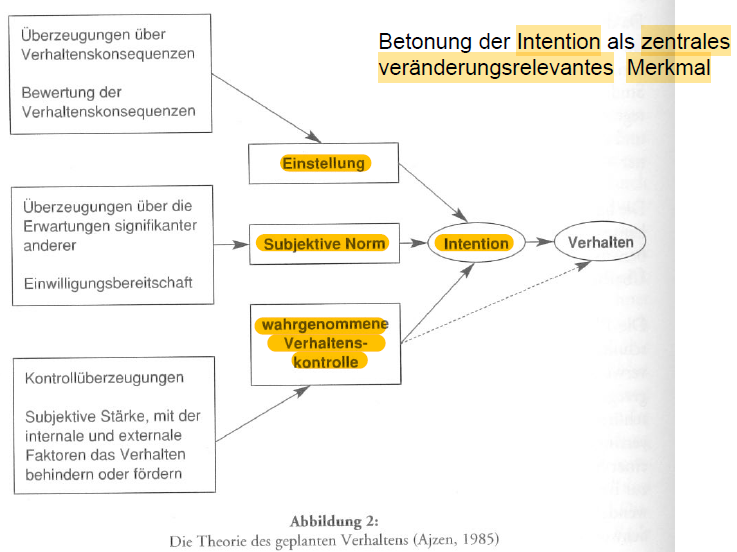
Programmtheorie - 1. Rahmenmodelle (Übergeordnete Paradigmen)
Rahmenmodelle (Übergeordnete Paradigmen)
Ursachen von Problemen epidemiologischer Untersuchungen - Inzidenz- / Prävalenzschätzungen
==> hfg. sehr ungenaue Inzidenz-/Prävalenzschätzungen mit hoher Variabilität, Ursache:
Aktualgenetische Veränderungsmodelle - Transtheoretisches Modell (TTM) der Verhaltensänderung (Prochaska & DiClemente, 1982ff.)
Transtheoretisches Modell (TTM) der Verhaltensänderung
Übersicht zur Kriminalitätsprävention
Übersicht zur Kriminalitätsprävention
Vor- und Nachteile verschiedener Interventionsstrategien - Universelle Prävention
Universelle Prävention
Vorteile
Nachteile
Sozialwissenschaftliche Modelle - Diathese-Stress-Modell
Diathese-Stress-Modell
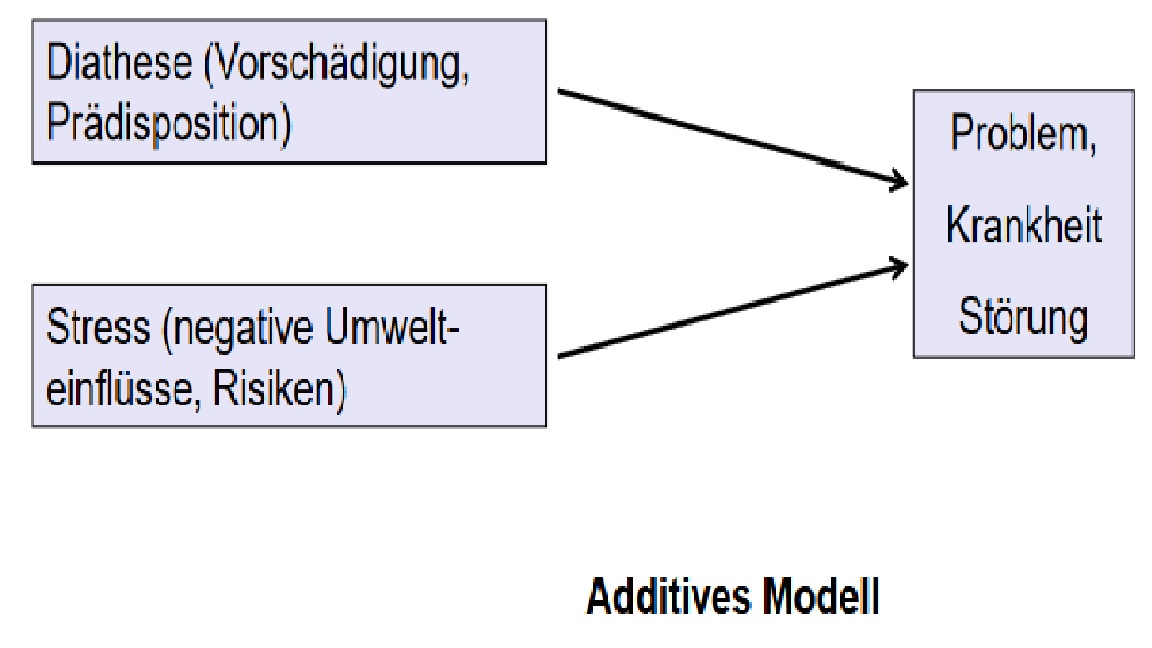
Programmtheorie - Beurteilungskriterien für Risiko-/Schutzfaktoren, Entwicklungsmodelle/Ätiologische Theorien
Beurteilungskriterien für Risiko-/Schutzfaktoren, Entwicklungsmodelle/Ätiologische Theorien
Aktualgenese - Lösungsversuche (Watzlawik, 1974)
Lösungsversuche als Ursache/ Aufrechterhaltung von Problemen:
Arbeitsdefinition - Psychologische Interventionen
Arbeitsdefinition - Psychologische Interventionen
- Geplanter Versuch der Veränderung von Verhalten und Erleben
- Orientierung an Normen oder Problemen
- Normen können wissenschaftlich sein!
Drogen-/ Suchtprävention - Präventionsansätze mit geringen Wirkungen oder unklarem Wirkprofil [4]
Präventionsansätze mit geringen Wirkungen oder unklarem Wirkprofil
Interventionstheorie - Rahmenbedingungen und Implementationsqualität
Empirische und praktische Bewährung - Ergebniszusammenfassungen - Review Organisationen
Review Organisationen
==> Erstellung und Verbreitung qualitativ hochwertiger Ergebniszusammenfassungen mit strengen Begutachtungsverfahren
Interventionstheorie - Soziale Interaktion
Merkmale Professioneller Kommunikation
Aktualgenetische Veränderungsmodelle - Transtheoretisches Modell (TTM) der Verhaltensänderung (Prochaska & DiClemente, 1982ff.)
Zusammenhang zw. Wahl der Methodik & Veränderungsphase
Interventionstheorie - Rahmenbedingungen und Implementationsqualität
Phasen der Etablierung von Implementationssystemen
Merkmale wirksamer Programme - Inhaltliche Konzeption [4]
Merkmale wirksamer Programme - Inhaltliche Konzeption
Prävention von Suchtproblemen - Präventionsansätze [7]
Prävention von Suchtproblemen - Präventionsansätze
Systematische Evaluation - Effektstärken Interpretationshilfen
Effektstärken Interpretationshilfen
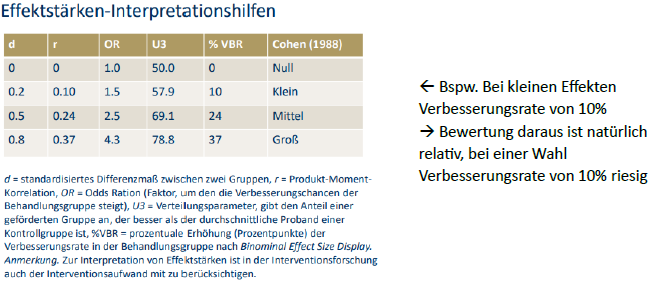
Formulierung einer Interventionstheorie - Informationsquellen für Durchführung und Implementation der Intervention [3]
Informationsquellen für Durchführung und Implementation der Intervention (= Interventionstheorie)
Kennwerte zur Beschreibung kategorialer Vergleiche epidemiologischer Daten - Selektionsrate
= Selektivität der Einschlusskriterien
Begriffsdefinitionen - Definiere die Kennwerte zur Beschreibung kategorialer Vergleiche epidemiologischer Daten (Kontingenztabelle grob erklären)
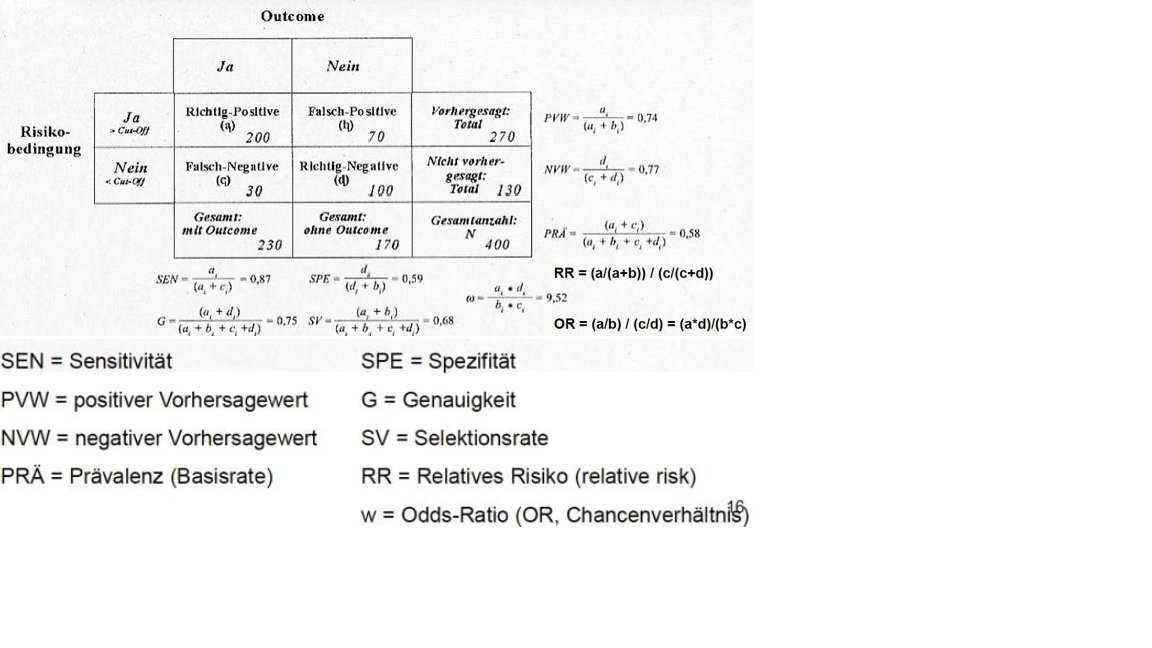
Gesundheitsförderung und Prävention - Unterschiede zwischen Gesundheitsförderung & Prävention
Unterschiede zwischen Gesundheitsförderung & Prävention
--> Begriffe werden hfg. synonym verwendet, obwohl sie untersch. Konzepte & Strategien umfassen
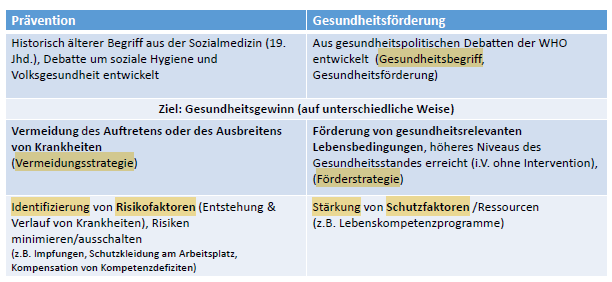
Übergeordnete Paradigmen Psychologischer Interventionen (Interventions-/ Krankheitsmodelle) [2]
==> lt. Beelmann nicht überholt, aber unvollständig
Interventionstheorie (WIE) - Grundlegende Annahmen zum Einfluss zielgerichteten professionellen Handelns [4]
WAS SIND 4 GRUNDLEGENDE ANNAHMEN ZUM EINFLUSS ZIELGERICHTETEN PROFESSIONELLEN HANDELNS?
Warum sind entwicklungspsychologische Erkenntnisse wichtig für die Gestaltung, Durchführung und Bewertung von psychologischen Interventionen?
Klassifikation von Interventionstypen (Prävention, Therapie, Rehab.)
[Tabelle]
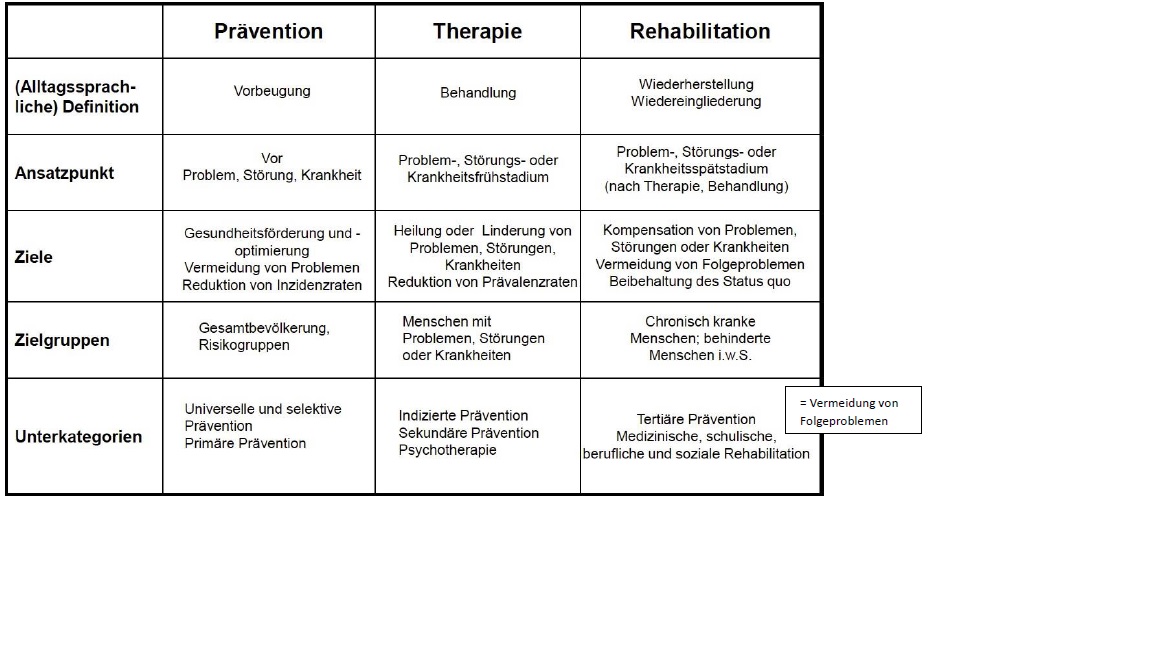
Systematische Evaluation - Wirksamkeit nach Art der Prävention
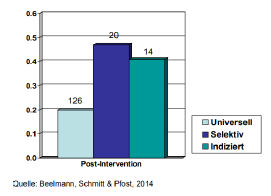
Drogen-/ Suchtprävention - Viel versprechende Präventionsansätze [4]
Viel versprechende Präventionsansätze
Empirische und praktische Bewährung - Evidenzbasierte Verzeichnisse
Kriterien angeben für:
(task force der APA)
Well-Established Treatments
oder
Aktualgenese - Prinzipien der Handlungsregulation (v.a. Piaget, 1977)
Handlungsregulation anhand von zwei grundlegenden Prozessen:
==> Prozess aktiver Gestaltung (Anpassung der Umwelt an menschl. Konzepte)
==> Anpassung des Menschen an Erfordernisse der Umwelt (Konzeptaneignung)
Implikationen für psych. Interventionen:
Rechtliche Grundlagen psychologischer Interventionen
Systematische Evaluation - Empirische und praktische Bewährung
Wirksamkeitsbegriffe
==> Wirksamkeit abfallend (efficacy > effectivenes > dissemenation)
Risiko- und Schutzfaktoren - Definition
Allgemein --> dynamisch wirksame Entwicklungsfaktoren, die das Risiko einer Fehlentwicklung erhöhen bzw. kompensieren
Risikofaktoren
Schutzfaktoren